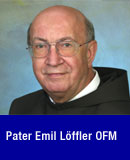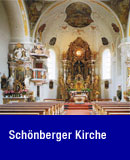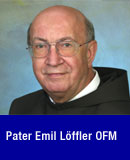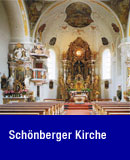Katholischer Gottesdienst
Sonntag, 11. 09. 2005, 10.00 Uhr - 11.00 Uhr,
ORF Regionalradios
Pfarrkirche
zum Hl. Kreuz in Schönberg, Tirol
24.
Sonntag im Jahreskreis
Der
Gottesdienst
Die Predigt
Pater
Emil Löffler
Die
Schönberger Kirche
Schönberg
im Stubaital
Der
Gottesdienst:
Musik:
Franz
Xaver Gruber: „Messe in D-Dur“
„Halleluja“
GL
638 "Nun singe Lob, du Christenheit"
GL
480 „Wir weihn der Erde Gaben“
Wolfgang
Amadeus Mozart "Ave verum"
GL
266 "Nun danket alle Gott"
P.
Heribert Rasch OFM "Ave Maria"
Ausführende:
Vorsteher
d. Gottesdienstes:
P.
Dr. Emil Löffler OFM
Der
Kirchenchor Schönberg
Leitung
und Orgel: Dr. Karl Mark
Von 11.15 bis 13.30 Uhr ist P. Dr.
Emil Löffler OFM für ein Gespräch unter der Tel. Nr.
05225 / 62543 zu erreichen.
P.
Dr. Emil Löffler OFM
Franziskaner der Tiroler Provinz, Jahrgang 1937
Promotion zum Dr. theol. In Salzburg (1971)
langjähriger hauptamtlicher Religionslehrer am
Gymnasium der Franziskaner in Hall in Tirol,
Pensionierung 1999.
Seit dem Jahr 2000 Pfarrer in Schönberg im Stubaital.
Über
die Entstehung der Schönberger Kirche
1348 soll die Pest fast das ganze Stubaital
ausgerottet haben. Im Jahre 1604 brach in Schönberg die Pest aus.
In kurzer Zeit raffte sie viele Menschenleben dahin. Als Dank für
die Errettung von der Pest gelobten die Bauersleute Anton und Maria
Steuxner, auf ihrem Grund ein Kreuz mit Maria und dem Apostel
Johannes aufzustellen. 1627 wurde zum Schutz gegen Witterungseinflüsse
über der Kreuzigungsgruppe eine kleine Kapelle erbaut. Sie wurde
später erweitert und den Pestheiligen Sebastian, Rochus und
Pirmin geweiht. Aus Berichten geht hervor, dass diese Kapelle eine
Zeitlang als Wallfahrtsort gegolten habe.
Die heutige Kirche zum heiligen Kreuz wurde als
letztes Gotteshaus des Stubaitales 1748/49 vom berühmten
geistlichen Baudirektor Franz de Paula Penz geplant und erbaut und
1750 vom Fürstbischof Leopold Graf von Spaur geweiht. Im
Stiftslibell werden u. a. als Spender der Pfarrer der Mutterpfarre
Telfes, die Wirtsfamilie Rott, Bauern aus Schönberg und Mieders
sowie eine Stiftung des Unterberger Kirchleins genannt. Mit der
Entstehung der Schönberger Kirche einher ging die Ernennung zur
Kuratie. 1891 wurde Schönberg zur Pfarre erhoben. Für die
Kirchenrestaurierung 1885 gewährte Kaiser Franz Josef eine Unterstützung.
Die jüngste Innen- und Außenrenovierung der Pfarrkirche Schönberg
wurde mit großer Umsicht und Einsatz in den Jahren 1981 bis 1984
unter Leitung des Ortspfarrers und Franziskanerquardians P. Siegmund
Schmid durchgeführt.
Schönberg
im Stubaital
Die
Geschichte von Schönberg ist eng mit der Brennerstraße verbunden.
Münzenfunde aus der Zeit der römischen Kaiser Trajan, Pupienus,
Victorin und Licianus beweisen, dass schon um die Zeitenwende über
„Schönenberge“ - so wird der Ort 1180 erstmals genannt - der
Brennerverkehr führte. Beim Parkplatz Europabrücke wurde ein Stück
der alten Römerstraße mit der gut erhaltenen Fahrrinne
konserviert. Peter Anich, der große Tiroler Kartograph,
verzeichnete in seiner Karte noch eine Burg Schönberg, an die nur
noch die „Burgwiese“ und eine 1932 entdeckte Zisterne erinnern.
Der
Brenner, niedrigster Alpenübergang in Westösterreich, begünstigte
schon in grauer Vorzeit den Verkehr von Nord nach Süd und
umgekehrt. Der Verkehr wiederum führte zu zahlreichen Ansiedlungen
entlang der Brennerstraße. Von allen Völkerschaften des Altertums
hinterließen die Römer die nachhaltigsten Spuren. Sie legten eine
Heerstraße an, die von Süden über Sterzing, Wilten, Zirl und
Scharnitz nach Norden führte. In angemessenen Abständen - auch in
Schönberg - richteten sie Raststationen ein. Der Verkehr brachte
den Menschen nicht nur Wohlstand, sondern auch Seuchen, die an der
Brennerstraße große Menschenopfer forderten.
Predigt
Schwestern
und Brüder!
Mit
Genugtuung, vielleicht auch mit etwas Schadensfreude haben wir das
Urteil des Königs über seinen unbarmherzigen Diener vernommen.
Recht geschieht ihm. Wie kann man nur so dumm sein, sich derart
daneben zu benehmen?
Ich
frage mich allerdings: War das nur Dummheit, die dem Diener jedwede
Einsicht in den objektiven Sachverhalt verbaute? Könnte es nicht
auch so gewesen sein, dass der Knecht gar kein schlechtes Gewissen
hatte, als er auf seinen Mitknecht losging? Vielleicht dachte er an
Recht und Gerechtigkeit, als er einforderte, was ihm doch scheinbar
auch zustand. Wir würden wohl darauf antworten: da stünde es doch
schlecht uni seine Gewissenserkenntnis, wenn er die Einsicht in den
wahren Tatbestand nicht erfassen habe können.
Hatte
er also ein irrendes Gewissen? Gegebenfalls ja. Die Frage ist
allerdings: Prägt er für sein irrendes Gewissen auch selbst die
Schuld? Denn es gibt zweifelsohne ein schuldhaft irrendes Gewissen
und ein unüberwindliches, d.h. den Irrtum nicht erkennendes
Gewissen, das mit persönlicher Schuld nichts zu tun hat.
Gestatten
Sie, dass ich bei diesem Thema ein wenig verweile: Jeder Mensch im
Gebrauche seiner Vernunft besitzt auch eine Gewissensanlage in
seinem Inneren. Die Väter des II. Vatikanums haben dies so ausgedrückt:
“Der
Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben
ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er
gerichtet werden wird“ (Kirche u. Welt, 16). Man hat mit Recht das
Gewissen beschrieben als eine Fähigkeit der praktischen Vernunft,
die sittlichen Forderungen zu erkennen, verbunden mit einem inneren
Antrieb, diesen Forderungen gemäß auch zu leben. Aber da es hier
um eine innere Anlage im Menschen geht, muss diese — wie jede
andere gute Anlage im Menschenherzen — entwickelt und entfaltet
werden. Das ist eine grundlegende Verpflichtung im Leben eines jeden
Menschen. Wer diese ständig verweigert, d.h. nach dem Motto lebt
“was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“, ist
verantwortlich für sein in vielen Fragen der Sittlichkeit irrendes
Gewissen. Wer sich andererseits im Leben um Gewissensbildung bemüht,
kann sich zwar auch einmal in einen Irrtum verfangen, trägt aber in
diesem Fall keine persönliche Verantwortung. Dazu noch einmal die Väter
des erwähnten Konzils: “Nicht selten (jedoch) geschieht es, dass
das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne dass es
dadurch seine Würde verliert. Das kann man aber nicht sagen“ —
auch das ist noch Zitat “wenn der Mensch sich zu wenig darum müht,
nach dem Wahren und Guten zu suchen, und das Gewissen durch Gewöhnung
an die Sünde allmählich fast blind wird“ (Kirche u. Welt, 16).
Ich
höre, wie man mir geradezu entgegen schreit: Wo bleibt da die
Gewissensfreiheit, die Meinungsfreiheit? Kein Zweifel: die
Gewissensfreiheit ist eines der höchsten Güter des Menschen überhaupt.
Aber Gewissensfreiheit ist doch keine Willkürfreiheit, nach der
Mensch tun und lassen kann, wonach ihm gerade zumute ist. Es hat
jemand den Satz geprägt: Die Freiheit des Gewissens ist nicht die
Freiheit vom Gewissen! Das heißt doch: Gewissensfreiheit ja, selbst
im Falle eines unüberwindlich irrenden Gewissens, aber nicht im
Falle des schuldhaft irrenden Gewissens. Denn aus einem solchen
Gewissen heraus zu handeln, wäre - theologisch ausgedrückt — sündhaft.
Bleibt
noch eine letzte Frage: Und woher nehme ich in der Gewissensbildung
jene Gesetze und Normen, auf die ein wahres und richtiges Gewissen
aufgebaut werden kann? Gewiss werden diesbezüglich Fachkenntnisse
auf verschiedenen Ebenen weiterhelfen, aber letztlich bleibt ein
Christ auf das die Gebote Gottes interpretierende Lehramt der Kirche
verwiesen. Ich darf ein letztes Mal das Konzil zitieren: “Bei
ihrer Gewissensbildung“, so lehrten die Vater, “müssen jedoch
die Christgläubigen die heilige und sichere Lehre der Kirche sorgfältig
vor Augen haben. Denn nach dem Willen Christi ist die katholische
Kirche die Lehrerin der Wahrheit“ (Religionsfreiheit, 14) — eine
Aussage, die für manche zum Stein des Anstoßes werden könnte.
Aber lassen Sie mich mit den Worten des jetzigen Heiligen Vaters
antworten: “Die von Christus dem Petrus und seinen Nachfolgern übertragene
Macht (eben z. B. das Lehramt) ist ... ein Auftrag zum Dienen ...
Der Papst ist kein absoluter Herrscher, dessen Denken und Willen
Gesetz sind. Im Gegenteil: Sein Dienst garantiert Gehorsam gegenüber
Christus und seinem Wort“ (Lateranbasilika, 7. Mai 2005).
Schwestern
und Brüder! Kehren wir zurück zu unserem heutigen
Evangelienabschnitt und lasst uns daraus folgern: Ein wahres und
richtiges Gewissen verlangt Einsicht in die eigene Sündhaftigkeit,
was auch das Erbarmen mit den an uns schuldig gewordenen Mitmenschen
mit einschließt. Nur eine solche Haltung wird uns die alles
verzeihende Liebe Gottes zuwenden. Amen.
|